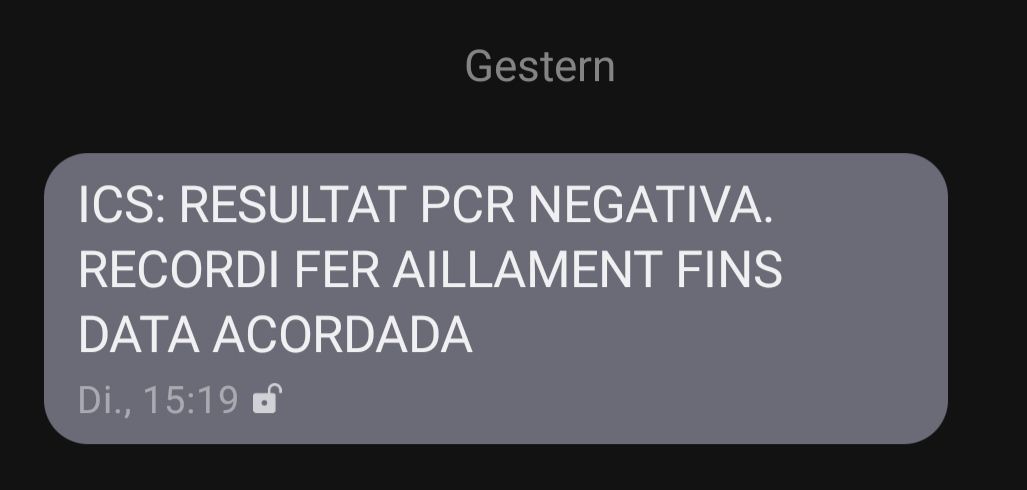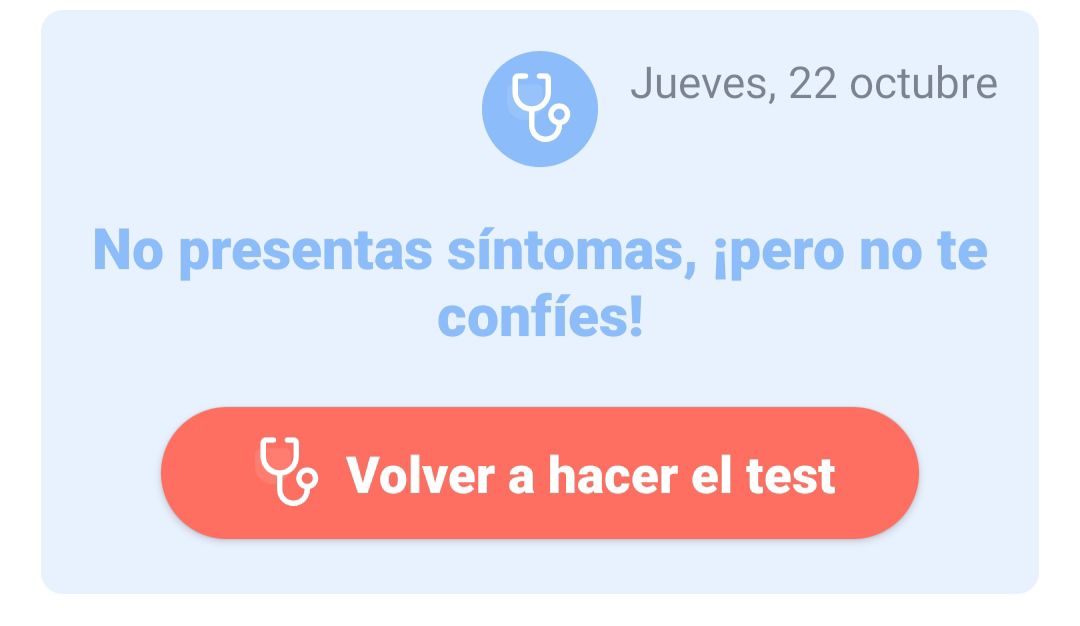Beim letzten Deutschlandbesuch fragte meine Cousine: “Und wie ist das so, Du bist ja jetzt ausgewandert?” “Jetzt bin ich die Ausländerin.” antwortete ich. Viel mehr fiel mir nicht ein. Das Gefühl, in einem anderen Land zu leben, lässt sich schwer in Worte fassen. Und sich einzugestehen, dass man vielleicht nie zurückkommt, ist nicht weniger schwierig. Als wir damals nach Spanien gezogen sind, war es ja zunächst nur ein Versuch. Wir hatten einige Jahre in Berlin gelebt und immer wieder tauchte das Thema auf: “Wollen wir irgendwann mal in Spanien leben?” Und wenn ja, wann?
Jetzt oder nie!
So kamen wir an den Punkt, zu sagen: Jetzt oder nie! Einen richtigen Zeitpunkt würden wir sowieso nie finden. Die Familienplanung hatten wir auch schon im Hinterkopf (damals wussten wir noch nicht, dass das nicht ganz so einfach werden würde) und der Gedanke, Kinder in Berlin zu bekommen, gefiel mir ganz und gar nicht. Ich mag Berlin, aber es ist für mich kein Ort, an dem ich meine Kinder großziehen möchte. Umso idyllischer war das Bild von einem kleinen spanischen Küstenort mit Strand und Meer und viel Sonne! Aber zunächst war das Thema Kinder für uns ziemlich weit entfernt, der Umzug und der Neuanfang in einem mir fremden Land standen im Vordergrund.
Also packten wir Kisten um Kisten, verkauften die meisten unserer Möbel und brachen eines Tages auf. So oft wir vorher in Spanien gewesen waren: diese Ankunft fühlte sich vollkommen anders an. Bis wir eine Wohnung fanden, wohnten wir in einer kleinen Ein-Zimmer-Wohnung von Freunden im Herzen von Barcelona. Noch war es ein bißchen wie Urlaub: Die Spaziergänge durch Barcelona, die fremde Wohnung, die Reisekoffer mit den nötigsten Sachen.
Dazwischen besichtigten wir Wohnungen. Vom ehemaligen Kosmetikstudio mit Milchglastüren und Dusche im “Wohnzimmer” bis hin zur Jugendstil-Altbauwohnung mit geschnitzten Blütenblättern im Türrahmen und Göttinnenstatue im Eingangsbereich war alles dabei. Der Wohnungsmarkt war (und ist immer noch) heiß umkämpft und die Makler drängten einen geradezu, sich sofort zu entscheiden. Niemand sagte “Schlaf nochmal drüber!” Hier hat man am besten schon die Maklerprovision bei der Besichtigung dabei, damit einem niemand die Wohnung unter der Nase wegschnappt.
Unsere erste Wohnung bekamen wir nur, weil wir gleich nach dem Besichtigungstermin zur Bank gingen und am Nachmittag Geld im Maklerbüro hinterlegten, “zum reservieren”. Würden wir uns anders entscheiden, wäre das Geld futsch gewesen. So ein Stress! Was, wenn wir in der Zwischenzeit eine schönere Wohnung finden würden? Wie war der Boden nochmal – war der nicht irgendwie häßlich gewesen? Ausgerechnet bei dieser Wohnung hatte ich kein einziges Foto gemacht! Und die Möbel sollten alle da drin bleiben? Und überhaupt, was war das für eine irre Idee, auf einmal in ein anderes Land zu gehen und dort einen Mietvertrag zu unterschreiben? War ich jetzt schon wirklich, richtig ausgewandert?
In solchen Momenten fliegt die Zeit. Keine Innehalten, kein Überdenken, wofür? – man ist ja schon längst da, die Spedition ist unterwegs, die alte Wohnung in Deutschland längst vermietet. Also haben wir den Mietvertrag unterschrieben und bald darauf die ersten Kisten ausgepackt. Haben erleichtert festgestellt, dass der Boden doch schönes Parkett ist und kein Imitat. Haben uns im neuen Leben eingerichtet: Da ist das Meer, da ist der kleine Laden um die Ecke mit dem guten Brot und der netten Besitzerin, das ist die Nachbarin auf dem Balkon, da ist der Supermarkt. Dabei bin ich in Gedanken an frühere Urlaube versunken. Diese verschlafenen kleinen Örtchen, durch die man manchmal kam und ein “zu verkaufen”-Schild sahst und dachtest: Was wäre wenn? Oder wenn man schon so lange an einem Ort war, dass man alle Wege kannte, “sein” Café hatte, seine Urlaubsroutine und Lieblingsorte und sich fragte: Was, wenn ich bleibe? So fühlte sich das Ankommen an.
Bleiben, wenn der Sommer vorbei ist
Der Winter kam und der Strand war leer und windig. Die Chiringuitos (die Strandbars) wurden abgebaut. Die Wellen schlugen höher und fraßen ein Stück vom Land. Die Bars und Plätze blieben leer. Man muss arbeiten, man hat seine Routinen, man muss einkaufen, man hat nicht viel Geld. Der Sommer ist für alle vorbei, nicht nur für die Touristen.
“Gehst Du oft ans Meer?” fragen mich die Freunde in Deutschland. “Nein”, sagte ich, “ich sitze viele Stunden am Tag am Computer und manchmal treffen wir Freunde und manchmal schauen wir einen Film oder wir gehen essen. Aber es ist immer da, das Meer, hinter dieser Straßenecke.”
“Geht ihr jeden Tag in den Wald? Fahrt ihr jeden Tag an den See?” brauche ich nicht zu fragen, denn ich weiß, ihr sitzt viele Stunden am Tag am Computer und manchmal trefft ihr Freunde und manchmal schaut ihr einen Film oder geht essen. So ist das, wenn man auswandert, man lebt dort einfach, in einem anderen Land.
So oft war ich schon umgezogen und hatte mir neue Städte erobert, dass ich wusste, ich muss nur warten. Irgendwann hat man Freunde, kennt man die Frau von der Gemüsetheke und hat seine eigene Karte von der Stadt im Kopf. Und dann ist man, ganz ohne es zu merken, angekommen.
Ankommen, aber wie?
Zugegebenermaßen war und ist es diesmal schwieriger. Die Tragweite meiner Entscheidung hat es mir nicht leicht gemacht, das neue Leben einfach zu genießen – schließlich bin ich nicht für unverbindliches Auslandssemester hergekommen. Und so ist jeder Moment des Ankommens hier immer auch ein erneuter Abschied. Ich sehe meine Kinder aufwachsen und verabschiede mich von der Idee, gemeinsam mit der besten Freundin tagtäglich am Spielplatz zu sitzen. Ich begrüße den strahlend blauen Himmel und verabschiede mich von rotem Herbstlaub und dem Frühlingserwachen. Ich finde neue Freunde und sehe deren Kindern langsam beim Wachsen zu, während meine Nichten und Neffen in Halbjahres-Sprüngen rasend schnell größer werden. Ich entscheide mich für einen Flug nach Berlin, kann dafür aber meine Familie nicht besuchen.
Die meiste Zeit lebe ich ganz einfach. Genieße die Sonne. Sehe die Kinder am Strand laufen und lasse mir den Winterwind um die Nase pusten. Freue mich über neue Bekanntschaften, über die leckeren Tomatensorten und die frühen Erdbeeren. Es gibt so viele tolle Feste und Feiern, die auf ihre ganz besondere Art und Weise gefeiert werden. Oft vergesse ich ganz, dass ich so einen großen Schritt gemacht habe. Mal bin ich noch Zuschauer, mal mache ich mit.
Dann muss ich an die Einwanderer in Deutschland denken und die Diskussion um Integration und Leitkultur. Seit ich selber in einem anderen Land lebe, frage ich mich: Was genau soll man denn auch machen? Was muss ich dafür tun? Die Sprache sprechen? Die Gebräuche übernehmen? Die eigenen Wurzeln über Bord werfen? Sich eingestehen, dass man vielleicht niemals zurück kommt und selbst wenn, sich vielleicht zu sehr verändert hat?
Egal was ich mache, wie gut ich die Sprache spreche und wie unauffällig ich mich verhalte: Ich werde immer die Deutsche sein. Das einzige was ich tun kann, ist mein Leben ganz für mich zu leben, so wie es mir gefällt. Das kann ich an jedem Ort der Welt tun. Aber wenn ich das schaffe, dann bin ich wohl “angekommen”, in meinem Leben.